IE: Journée mondiale des enseignants 2005:SEW-Konferenz zur Reform der Lehrerausbildung (Journal 5/2005)
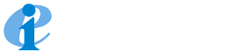
Bessere Ausbildung für Lehrer
Im Rahmen der "Journée Mondiale des Enseignants" organisierte das SEW am 5. Oktober eine Konferenz über die reformierte Lehrerausbildung an der Universität Luxemburg.
Zwar befürwortet SEW-Präsidentin Monique Adam eine bessere und wissenschaftlichere Ausbildung junger Lehrer, den neuen "Bachelor"-Lehrgang der "Uni Lëtzebuerg" bezeichnete sie aber als "faulen Kompromiss". So ist ein "Bachelor" von vier Jahren vorgesehen, in dem der Studierende 240 so genannte ECTS-Kredite erreichen muss. Einen herkömmlichen "Bachelor" erreicht man jedoch mit 180 Kreditpunkten, einen Master mit 300. In diesem Zusammenhang bedauert Adam, dass der neue Lehrgang keinen vollwertigen Master vorsieht und hofft, dass es sich lediglich um eine Zwischenlösung handelt.
Zudem sei die neue Regelung in vielen Bereichen unklar. U. a. stelle sich die Frage, ob der "Bachelor"-Lehrgang im Ausland anerkannt sei und zu einem Master an einer ausländischen Universität berechtige. Unklarheit gebe es auch bei der Weiterbildung und im Hinblick auf die Gleichstellung mit dem Lehramtsstudium in Belgien, das nur drei Jahre vorsieht.
Klärungsbedarf
Fakultätsdekan Lucien Kerger musste gleich zu Beginn seiner Erläuterungen einräumen, dass auch er auf viele dieser Fragen keine definitive Antwort geben könne. Kerger unterstrich jedoch die Notwendigkeit der neuen Ausbildung und verteidigte das neue Konzept. Um den Anschluss an die Wissensgesellschaft nicht zu verpassen, sei in Luxemburg eine höhere Professionalität der Schule und ihrer Akteure unumgänglich. Kerger begrüßt ausdrücklich das neue Lehrerprofil, das auf Erziehungswissenschaften, Interdisziplinarität sowie Multiperspektivität setzt. Die Ausbildung beruhe auf wissenschaftlichen Fakten und sei im Ergebnis fundierter. Die "Bachelor"-Ausbildung setze vermehrt auf Produktion, und weniger auf Reproduktion. Außerdem müssten die Studenten fähig sein, im Team zu arbeiten und die neuen Kommunikationstechnologien adäquat zu nutzen. Zwar sei die Zahl der Pflichtkurse gesenkt worden, der Arbeitsaufwand für Studenten sei allerdings gestiegen. Die neue Ausbildung verlange von angehenden Lehrern mehr Eigenverantwortung. Kerger verteidigte zudem die Mobilitätspflicht für Studenten und fordert eine Reform des "stage pédagogique". Wichtig sei auch die Reform der Zulassungsbedingungen, die vermehrt auf Sprachkompetenz setze und das Abiturresultat nicht mehr beachte.
Unterrichtsministerin Mady Delvaux-Stehres ihrerseits unterstrich die tragende Rolle der Lehrer im Bildungssystem. "Die Schule steht und fällt mit der Qualität der Lehrer", betonte die Ministerin. Delvaux plädiert für "polyvalentes" Personal an den Schulen und fordert zudem eine enge Partnerschaft mit den Eltern Zudem spricht sie sich für ein Uni-Netzwerk in der Großregion aus, das auch im Bereich der Weiterbildung Akzente setzen könne. Jeder Lehrer müsse die Möglichkeit haben, einen "Master" in Erziehungswissenschaften nachzuholen.
Die Ministerin weist auch auf die Notwendigkeit einer Reform des "Concours" hin. Außerdem fordert sie eine Aufstockung der Mittel für Forschung. "Es fehlt dramatisch an Forschung in diesem Bereich", stellt Mady Delvaux-Stehres fest. Insgesamt zeigt die Ministerin sich zufrieden mit der neuen Lehrerausbildung und fordert: "Nun muss die Uni beweisen, dass die neue Ausbildung Früchte trägt".
(tageblatt - 7. Oktober 2005)
