Nationaler Bildungsbericht 2018 – alarmierend
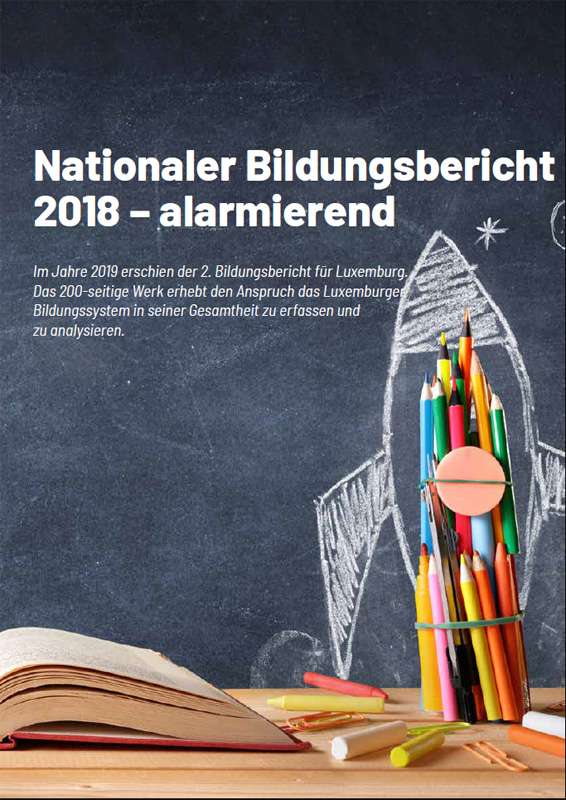
 Der Bildungsbericht 2018
Der Bildungsbericht 2018
SEW weiter ablehnend zur Steuerung des Bildungssystem ausschließlich über standardisierte Tests
Das SEW/OGBL bleibt weiter bei der ablehnenden Haltung einer Steuerung des Bildungssystems über die Resultate standardisierter Tests. Die Ziele der formalen Bildung dürfen sich nicht auf die Vermittlung von standardisiert messbaren Kompetenzen reduzieren. Ohne hier noch einmal auf den Kern dieser Debatte eingehen zu wollen, sollte bemerkt werden, dass trotzdem die Auswertung der über die „epstan“ gesammelten Daten in der längsschnittlichen Analyse wichtige Erkenntnisse über die schulische Entwicklung der Schüler im Bezug auf ihre sprachliche Herkunft und ihren sozioökonomischen Hintergrund erkennen lässt.Obwohl der Bildungsbericht den interessierten Leser mit Zahlen und Statistiken förmlich überwältigt wird in vielen Artikelndie quantitative Analyse auch durch eine qualitative ergänzt.
Erklärte Ziele des Bildungsbericht In seinem Vorwort erheben die Koordinatoren des Berichts den Anspruch „ein differenziertes Bild der Bildung in Luxemburg“ zu entwerfen und damit „die Grundlage für eineinformierte Debatte über Schule und Erziehung“ zu bieten.
Allerdings scheint das Ziel sich „an alle Akteure und eine interessierte Öffentlichkeit“ zu richten, sich kaum zu realisieren.
Der Minister persönlich blieb der Vorstellung des Berichts fern und bei der Presse, die dem Bericht lediglich einige Artikel widmete, kann man gewisse Abstumpfungserscheinungen erkennen, da die Erkenntnisse, obwohl sehr alarmierend, sich doch immer wiederholen. Außerdem Versand einiger Exemplare des Berichts an die Schulen vermieden die politischen Entscheidungsträger des Ministeriums einen Austausch mit den Gewerkschaftenoder anderen Akteuren, die in den Schulen mit den Kindern und Jugendlichen arbeiten.
Ziel der Konferenz von SEW, FGIL und Landesverband war es deshalb die Debatte in die Schulen zu tragen. Der Bildungsbericht beschränkt sich auf die Analyse der Daten und verzichtet weitgehend auf eine Wertung. Die qualitativen Erhebungen orientieren sich an den politischen Zielsetzungen und prüfen inwiefern die nationalen und internationalen politischen Vorgaben in die Praxis umgesetzt wurden.
Eine Kritik der Schulpolitik findet nicht oder nur ganz andeutungsweise statt. Das hat zur Folge, dass verschiedene Beiträge, wie z.B. das Kapitel über die non-formale Bildung im Vorschulalter teilweise wie das gemeine Selbstlob des Ministers klingen, da sie sich auf die Analyse beschränken inwieweit die politischen Ziele auf gesetzlicher Ebene realisiert wurden. Manchmal fehlt der Bezug zur Praxis. Die Frage, welchen Einfluss die Pädagogisierung der frühen Kindheit in non-formalen Bildungseinrichtungen auf die Entwicklung der Kinder hat wird nur ganz zum Schluss gestellt. Eine Meinung, gestützt auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, erlaubt sich der Bericht nicht.
Wichtige Erkenntnisse des Bildungsberichts
Antizipierend darf verraten werden, dass die wichtigsten Erkenntnisse des Bildungsberichtes, die das SEW hervorstreichen möchte, nicht neu sind.Schulischer Erfolg und Misserfolg sind durch den sozioökonomischen Hintergrund der Kinder bestimmt. Von Chancengerechtigkeit oder gar Chancengleichheit ist unser Schulsystem weit entfernt. Dieser Umstand, der schon in der MAGRIP-Studie Ende der sechziger Jahre des vergangen Jahrhunderts angeprangert wurde bestimmt noch immer den schulischen Werdegang der Schüler. Er hat sich, und das ist der eigentliche Skandal, in den letzten Jahren verstärkt. In anderen Worten: die Reformen der letzten Jahre begünstigen die Chancen der Sprösslinge besser gestellter Eltern und benachteiligen die Kinder aus bildungsfernen Bevölkerungsschichten (Siehe Grafik).

Der Übergang von der Grundschule zu einer weiterführenden Schule ist nicht nur ein Schulwechsel, sondern gleichzeitig auch eine wichtige Entscheidung über den weiteren Verlauf der Bildungskarriere eines Kindes, die sich ebenfalls auf eine spätere Berufswahl auswirkt.
Thomas Lenz bemerkte dazu sehr treffend, dass die Grafiken auch den Grundstückspreis in den verschiedenen Gemeinden widerspiegeln.
Dass in der Gemeinde der Stadt Luxemburg trotz einer größtenteils sehr wohlhabenden Bevölkerung nur proportional weniger Kinder in den ES (ESC) orientiert werden, ist dadurch zu erklären, dass die Grafiken nur die Orientierung in die öffentliche Schule spiegeln. Inzwischen ziehen es wohl viele Bessersituierte es vor die Kinder in Privatschulen zu schicken.
Das SEW unterstützt allerdings die Politik des Bildungsministers nicht, der Schüler sogenannte „International Schools“ anbietet, was letztlich die Gefahr beinhaltet, dass Schüler Sprachen oder Fächer, die ihnen Schwierigkeiten bereiten, sozusagen abwählen.
Im Zusammenhang der Orientierung wirkte die Aussage, das sich nach der Reform der Prozedur der Orientieren die „Lage verbessert“ habe und nun wieder mehr Kinder in das ESC orientiert werden.
Das liegt wohl kaum in einer verbesserten Prozedur, sondern ist nur dem Umstand geschuldet, dass der Einfluss der Eltern indirekt auf die Entscheidung gestärkt wurde und die Lehrerinnen und Lehrer der Cycle 4 die Botschaft verstanden haben und den Wünschen der Eltern gerecht werden.
Da die Kinder am Ende des Cycle 4 wohl kaum in der Summe eine Verbesserung der geforderten Kompetenzen und Kenntnisse aufweisen dürften, wäre eine vergleichende Studie über die letzten Jahre sehr aufschlussreich.
Der Bildungsbericht analysiert den Einfluss der Sprachensituation der Kinder und den Einfluss des sozioökonomischen Hintergrunds in getrennten Kapiteln. Es wäre sicher sehr aufschlussreich den sozioökonomischenHintergrund mit der Sprachensituation zusammen zu untersuchen.
 Die wohl wichtigste Erkenntnis, die sich deckt mit dem Feedback aus den Schulen, ist der Fakt, dass am Ende des Cycle 2, am Anfang des dritten Schuljahres, mehr als ein Drittel der Schüler das „niveau socle“ nicht erreicht haben und damit nicht die notwendigen Kenntnisse und Kompetenzen entwickelt haben um dem Unterricht im Cycle 3 zu folgen.
Die wohl wichtigste Erkenntnis, die sich deckt mit dem Feedback aus den Schulen, ist der Fakt, dass am Ende des Cycle 2, am Anfang des dritten Schuljahres, mehr als ein Drittel der Schüler das „niveau socle“ nicht erreicht haben und damit nicht die notwendigen Kenntnisse und Kompetenzen entwickelt haben um dem Unterricht im Cycle 3 zu folgen.Die Verantwortung dafür tragen nicht die Lehrerinnen und Lehrer, sondern die Frage drängt sich auf, ob im Cycle 2 die Anforderungen für diese Schüler nicht einfach zu hoch sind. Wird im Cycle 2 von diesen Schülern zu viel verlangt? Oder anders gestellt: Warum sind die Anforderungen für diese Schüler zu hoch?
Dieser Rückstand kann im Laufe der Schulzeit nicht mehr aufgeholt werden. Der Bericht zeigt auf, dass die Schulkarrieren ab diesem Zeitpunkt sehr vorherbar sind. Da ist der eigentliche Skandal den der Bildungsbericht aufzeigt. Man könnte wohl erwarten, dass dementsprechend Reaktionen aus dem Ministerium kommen und der Minister die Schulpartner eiligst zusammen ruft um entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.
Aber nichts geschah. Im Gegenteil, der Minister zündete eine weitere Nebelkerze und verkündete medienwirksam, dass Schüler jetzt „kodieren“ lernen.
Das SEW/OGBL weist noch einmal mit Nachdruck auf seine Forderung hin, dass in unserem Schulsystem das Hauptaugenmerk sich besonders auf die ersten Jahre richten sollte. Die Kinder weisen zu Beginn des ersten Schuljahrs Unterschiede von bis zu 3 Jahren auf. Viele Kinder, und es scheinen immer mehr zu werden, sind nicht schulreif. Es müssen also Maßnahmen getroffen werden, die diesem Umstand Rechnung tragen und den Bedürfnissen der Kinder gerecht werden. Die Lernschwierigkeiten der Kinder später zu überwinden ist sehr kosten- und personalintensiv und führt nicht zu nennenswerten Verbesserungen. Die Erkenntnis ist nicht neu und die Finnen haben es längst erkannt; der Anfang ist wichtig, oder wie es der vormalige DGB-Chef Sommer zusammenfasste: „Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr.“
Insgesamt muss man anerkennen, dass der Bildungsbericht wichtige Problemfelder aufzeigt, auch wenn man sich wünschen würde, wenn sich an manchen Stellen explizitere Handlungsvorschläge oder gar Kritiken finden würden. Auch dann wenn sie damit der aktuellen Schulpolitik widersprechen würden.
Den ganzen Bildungsbericht kann man sich vom SCRIPT schicken lassen, oder aus dem Internet herunterladen: www.bildungsbericht.lu
Patrick Arendt
